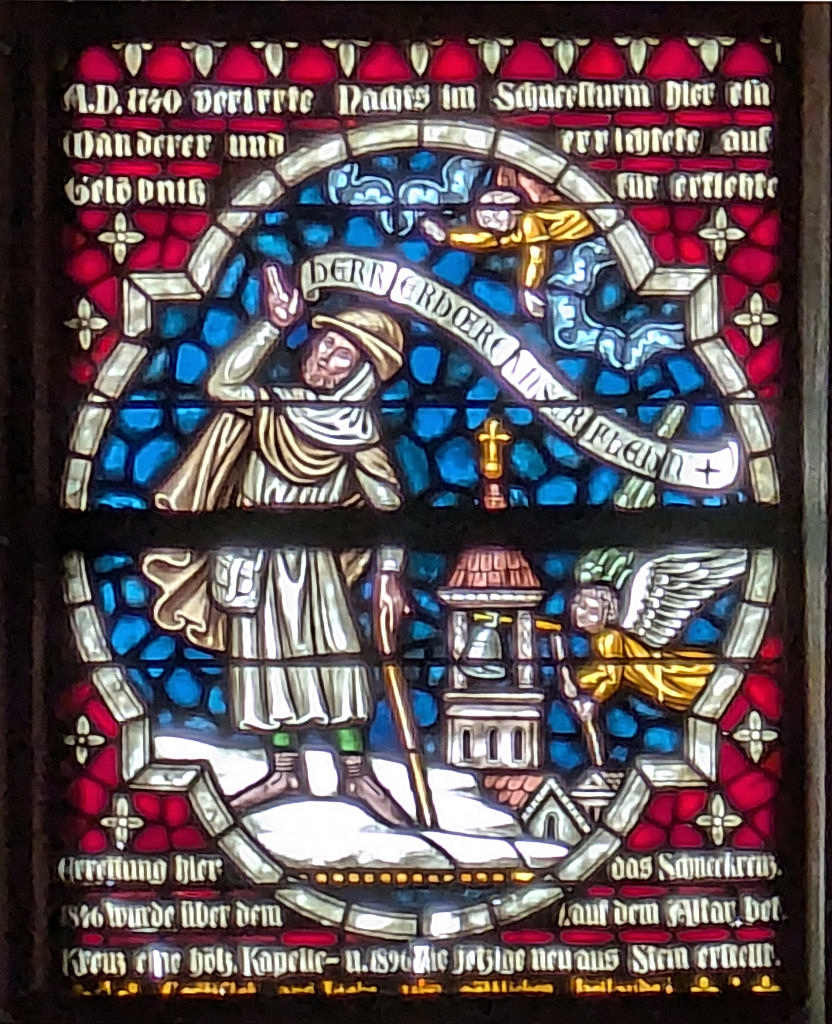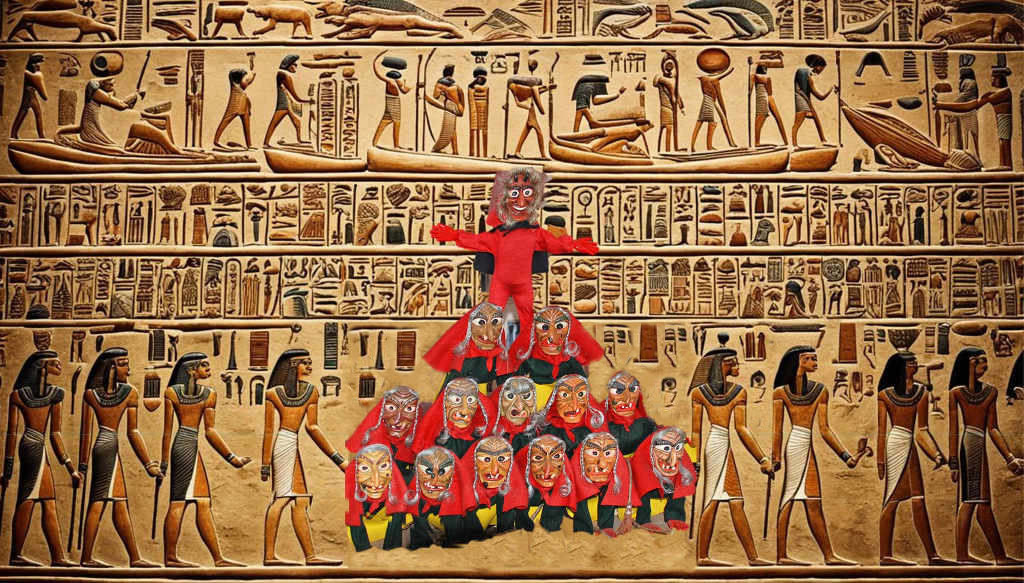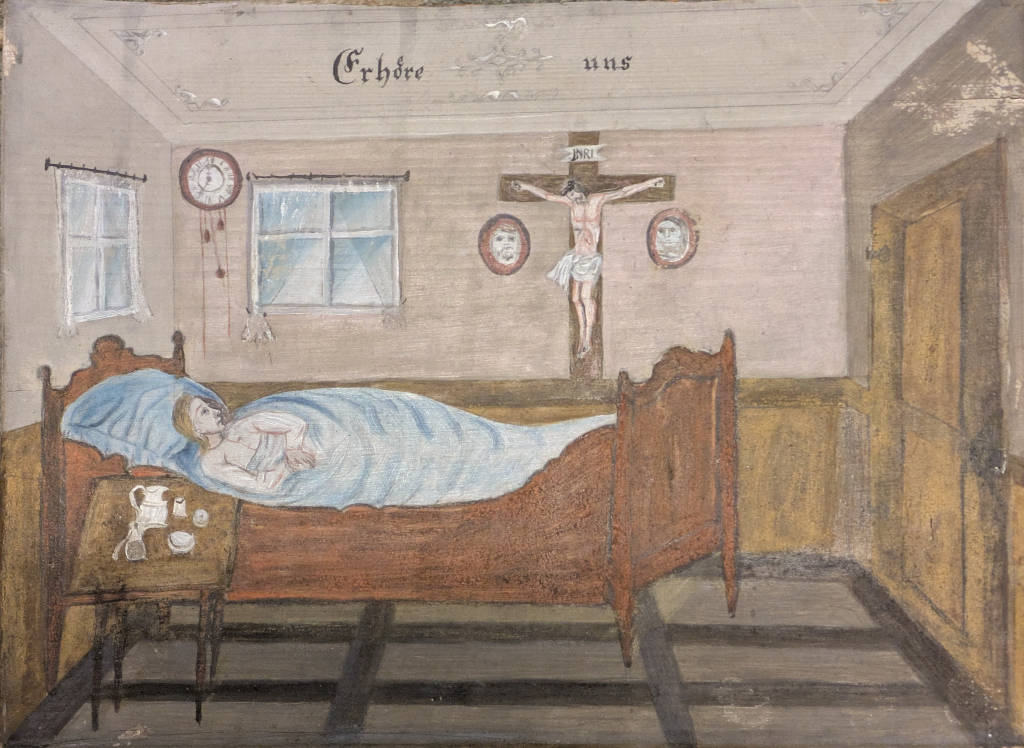Dieses Foto stellte dankenswerterweise Familie Willmann zur Verfügung.
Über Jahrzehnte hinweg gehörte Rita Willmann (1938–2025) fest zum Bild des städtischen Lebens: Wo in Löffingen gefeiert wurde, war sie mit ihrer Kamera zur Stelle. Ob Festumzüge, Fasnacht, Erstkommunion oder Hochzeitsfeier – sie hielt die großen und kleinen Momente fest, die das Gemeinschaftsleben prägten. Zehntausende Aufnahmen entstanden im Laufe der Jahre. Ihre Negative stellte sie dankenswerterweise für unsere Website loeffingen-damals.de zur Verfügung – ein unschätzbares Geschenk an das kollektive Gedächtnis der Stadt.
Geboren wurde Rita Wittler am 20. März 1938 in Bochum. Nach dem frühen Tod des Vaters zog sie mit ihrer Mutter Klara Wittler (geb. Assmuth, 1907–1999) nach Löffingen. Dort heiratete die Mutter Anselm Zepf (1898–1989). Nach der Volksschule begann Rita Wittler 1952 eine Lehre im Schreibwaren- und Druckereigewerbe. 1958 heiratete sie den Buchbinder Albert Rebholz (1907–1962). Gemeinsam eröffneten sie 1960 am Rathausplatz eine Druckerei mit angeschlossenem Schreibwarengeschäft. Zwei Jahre später starb ihr Ehemann am 21. April 1962 nach langer Krankheit. Sie stand nun als alleinerziehende Mutter eines Kindes und mit einem Geschäft allein da. Sie verkaufte die Druckerei und führte das Schreibwaren- und Fotogeschäft weiter. Am 16. September 1967 heiratete sie den Postbeamten Josef Willmann aus Neustadt. Mit ihm bekam sie zwei weitere Kinder. 1985 zwang sie ihre Gesundheit, beruflich kürzerzutreten, und sie verpachtete das Geschäft. Neben ihrer Arbeit engagierte sich Rita Willmann mit großem Herz in der Gemeinschaft: im Turnverein und im Schwarzwaldverein ebenso wie in der katholischen Kirchengemeinde, wo sie im Pfarrgemeinderat und Stiftungsrat mitarbeitete und als Lektorin und Kommunionhelferin tätig war. Rita Willmann verstarb am 8. Oktober 2025. Sie wurde auf dem Friedhof in Löffingen beigesetzt. Das hier gezeigte Porträtfoto zierte das Programmblatt ihrer Trauerfeier – und zeigt sie so, wie sie vielen in Erinnerung bleibt: mit einem offenen Lächeln, freundlich und zugewandt.
Standort des Fotografen: ???