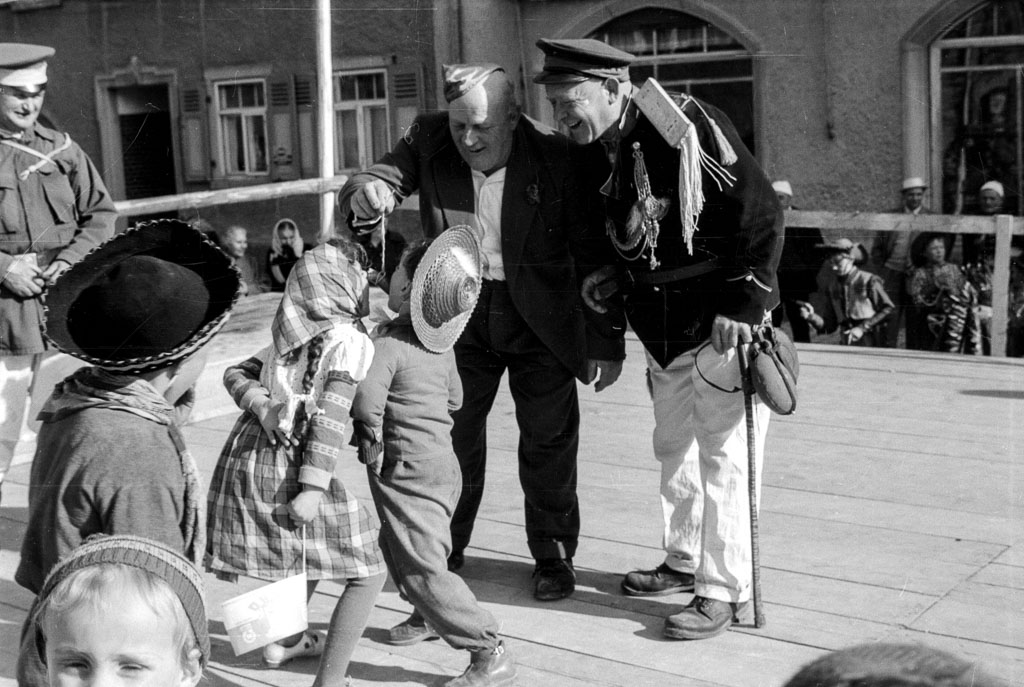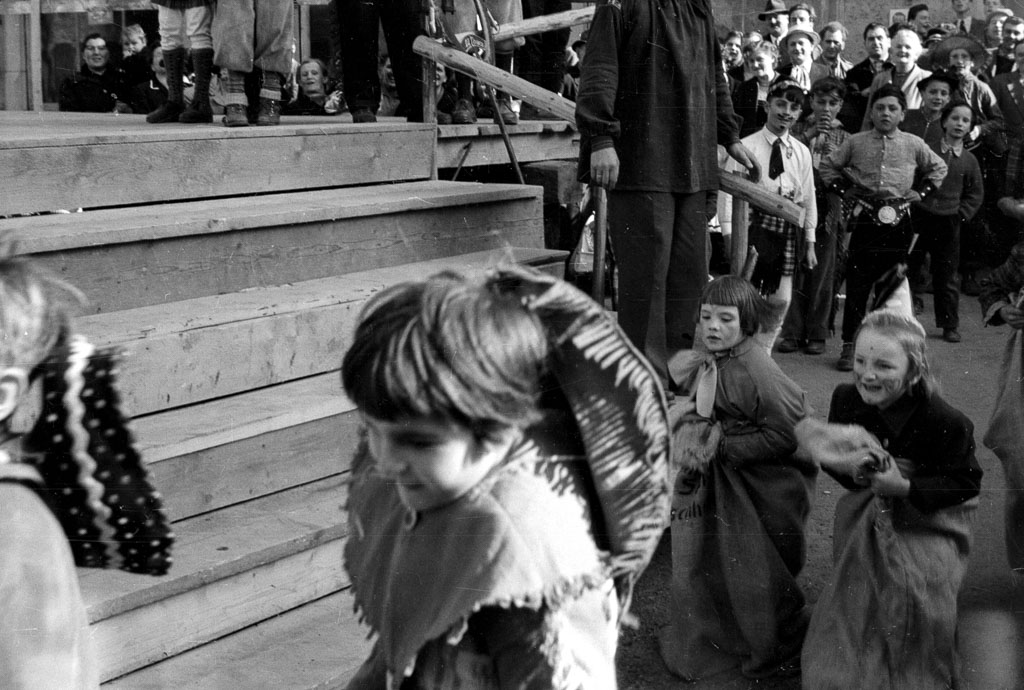Verlag Chr. Franz, Titisee
Dieses Foto stellte dankenswerterweise Matthias von Dungen zur Verfügung.
Auf exakt »802 m.ü.M« liegt Löffingen – und dazu im »Schwarzwald«. So steht es gedruckt auf der Vorderseite der Ansichtskarte. Zu sehen ist ein Blick vom Reichberg auf das Städtchen. Noch hat das große Bauen jenseits der Bahnlinie nicht begonnen. Da wo auf der Wiese noch die Blumen üppig blühen, werden in den 1950er und 60er Jahre zahlreiche Neubauten entstehen. Die Gartenstraße und Scheffelstraße werden neu angelegt. Doch das ist Zukunftsmusik. Bislang stehen nur in der Bonndorfer Straße die ersten Häuser.
Das Motiv der Ansichtskarte wird in den frühen 1950er Jahren aufgenommen. Das 1949 erbaute Haus Gwinner (Seppenhofer Str. 2) ist noch nicht verputzt. Und der 1957 eingeweihte Erweiterungsbau des städtischen Krankenhauses (Seppenhofer Str. 7) ist noch nicht errichtet. Ob die 1953/54 erbaute evangelische Kirche schon existiert, ist eider nicht zu erkennen, da ihr Standort am rechten Bildrand abgeschnitten ist. Vermutlich hätte der Fotograf sie aber mit auf das Bild genommen.
Standort des Fotografen: 47.878858, 8.343602