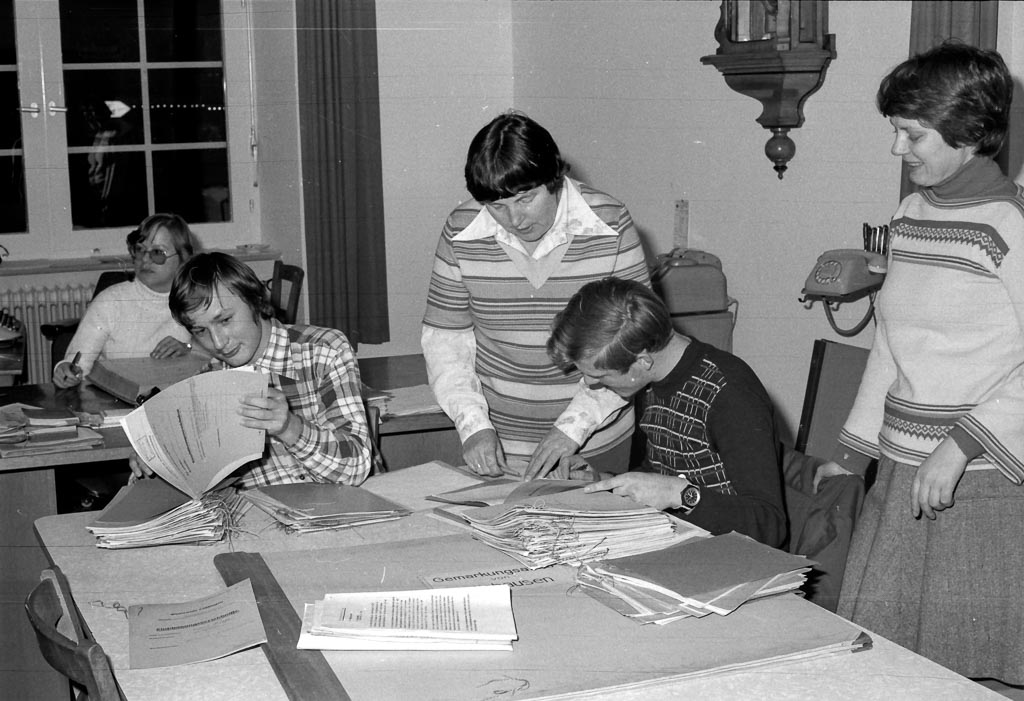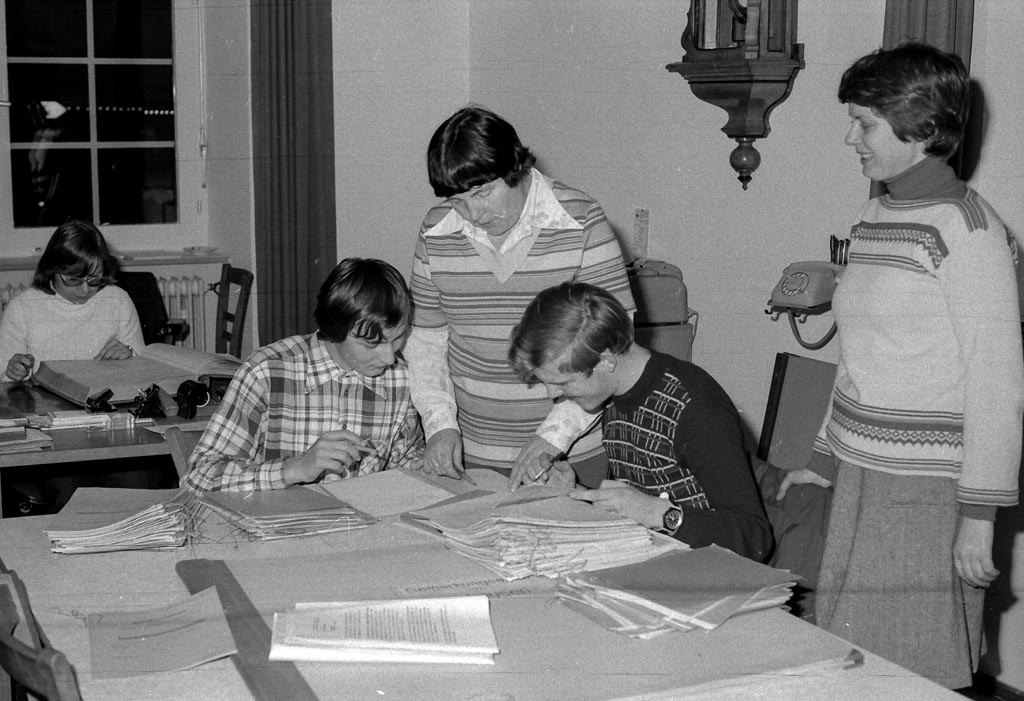Dieses Foto stellten dankenswerterweise Christa Egle und Hans-Peter Hepting zur Verfügung.
Acht junge Männer stehen auf dem unteren Rathausplatz. Links hinter ihnen sind die Bäckerei Ritter (Rathausplatz 5) und die Metzgerei Riegger (Rathausplatz 4) zu sehen. Recht hinter ihnen erhebt sich das Rathaus. Und ganz im Hintergrund ist das Haus Vogt (Rathausplatz 13) zu sehen. Die meisten Männer tragen Anzug, nur der Mann ganz rechts, Hermann Schultheiß, trägt Wehrmachtsuniform. Was im ersten Moment nach einem harmlosen Gruppenfoto aussieht, bekommt im zweiten Moment einen bitteren Beigeschmack. Offenbar ist schon Krieg, vielleicht entsteht das Gruppenfoto anlässlich der Einberufung eines Soldaten? Wird man sich nach dem Krieg wiedersehen?
V.l.n.r.: 1 ???, 2 ???, 3 ???, 4 Fritz Schlenker (1912-?), 5 Erwin Egle (1915-1948), 6 ???, 7 ???, 8 Hermann Schultheiß
Erwin Egle, der 5. von links, stirbt am 12. Mai 1948 in sowjetischer Kriegsgefangenschaft. Er wird nur 33 Jahre alt.
Am Rathauseck sind ein Pfeil und die Zahl »41« auf das Wand gemalt. Ob das ein Hinweis für Truppentransporte ist? 1937 war die Fassade vom Haus Ritter noch mit einer Kletterpflanze bewachsen. Das Foto wird also definitiv erst danach aufgenommen.
Standort des Fotografen: 47.883911, 8.344045