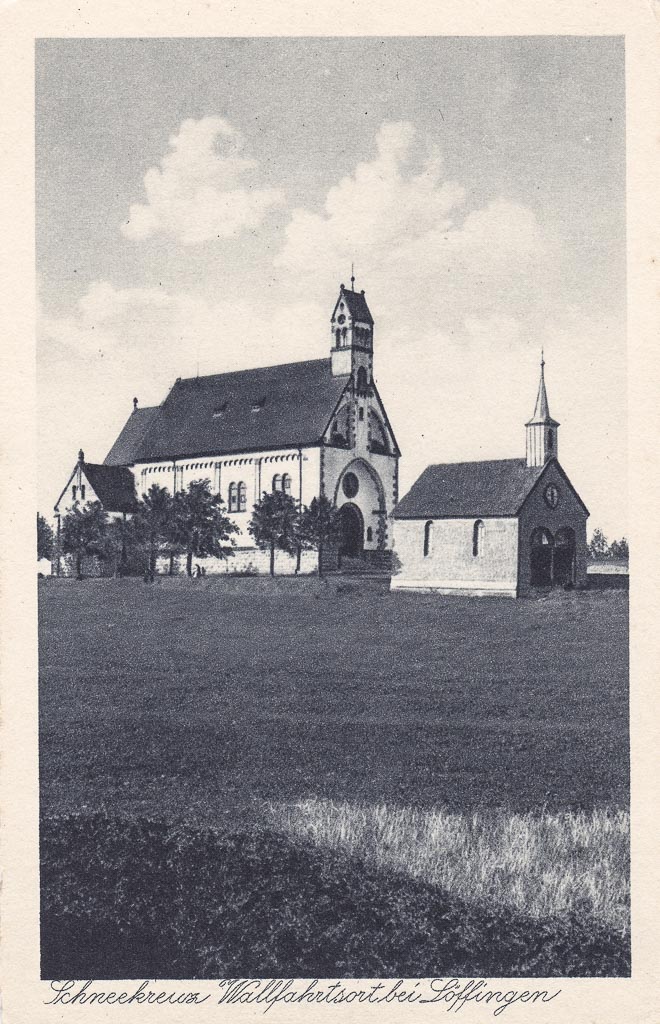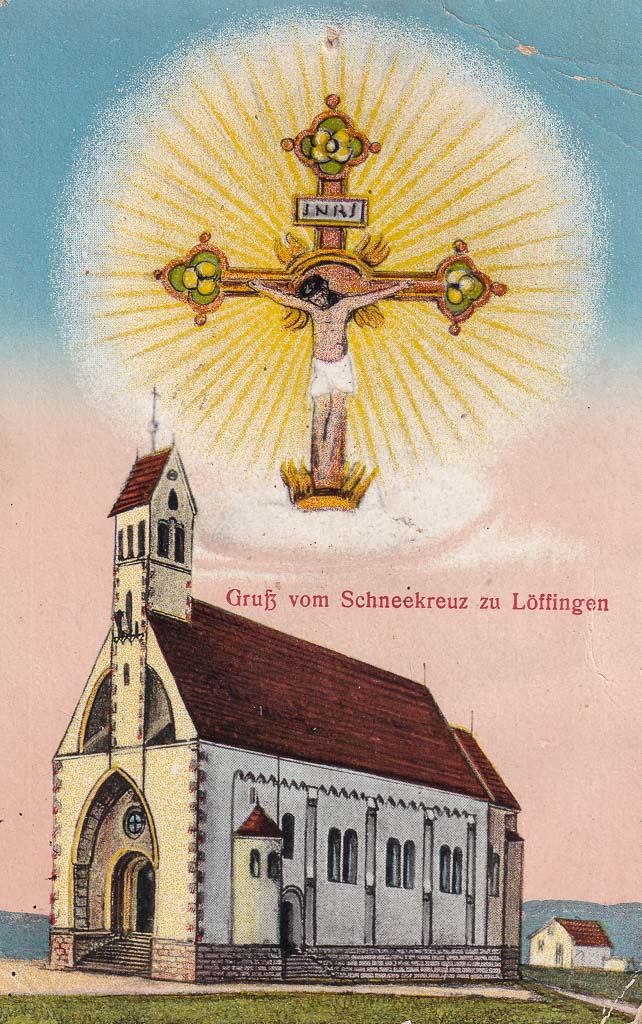Dieses Foto stellte uns dankenswerterweise Helmut Egy zur Verfügung.
Ein außergewöhnlicher Blick zeigt dieses Foto, das vom Kirchturm der Wallfahrtskirche zum Witterschnee aufgenommen wurde. Aus luftiger Höher schweift der Blick über die hölzerne Wallfahrtskapelle hinweg, vorbei am Gasthaus »Engel« (Beim Schneekreuz 1) und den Verkaufsbuden, die an der Maienlandstraße stehen. In ihnen werden Andenken und religiöse Artikel an Wallfahrer verkauft. Über Wiesen hinweg wandert der Blick, immer dem Verlauf des Stadtbaches und der Bahnlinie folgend in Richtung Städtchen. Die ersten Häuser im Maienland grüßen aus der Ferne. Der hintere Teil des Alenbergs ist noch unbebaut. Zu erkennen sind außerdem der aufragende Kirchturm der katholischen Pfarrkirche St. Michael und die beiden Schornsteine des Sägewerk Benz. Auch die Oberwiesenwegbrücke, die über die Bahnlinie führt, ist zu sehen.
Standort des Fotografen: 47.893286, 8.336055