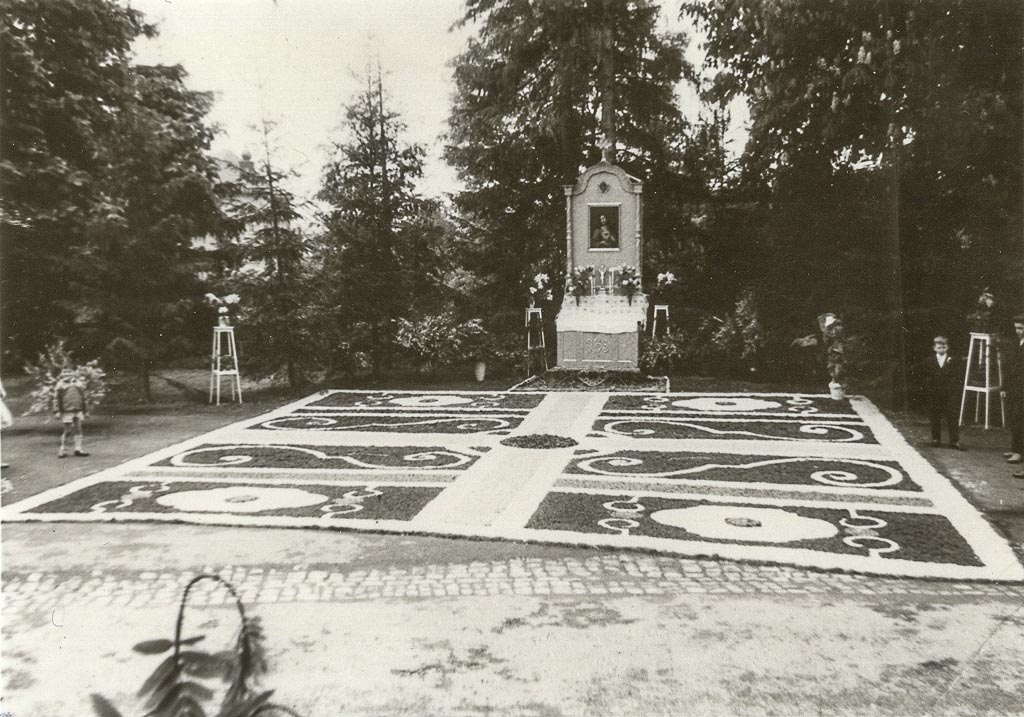Dieses Foto stellte dankenswerterweise Paul Heizmann zur Verfügung.
Es hat geschneit! Familie Heizmann fotografiert aus ihrem Fenster heraus die weiße Pracht. Auf der asphaltierten Oberen Hauptstraße ist der Schnee bereits wieder verschwunden. Aber auf der gegenüberliegenden Straßenseite sieht es noch recht winterlich aus. Die Äste und Zweige eines Obstbaums im Garten von Familie Selb sind weiß bedeckt. Und auch auf dem Dach bei Wölfles (Obere Hauptstr. 14) liegt eine dünne Schicht Schnee.
Standort des Fotografen: 47.884548, 8.347710