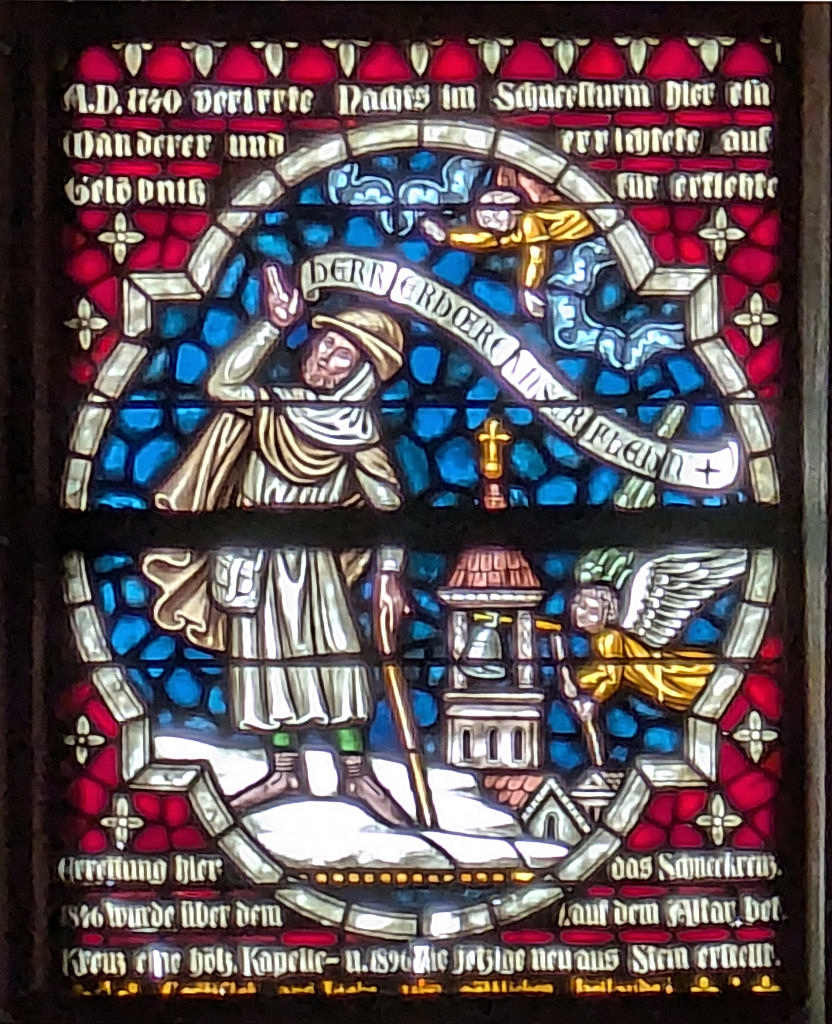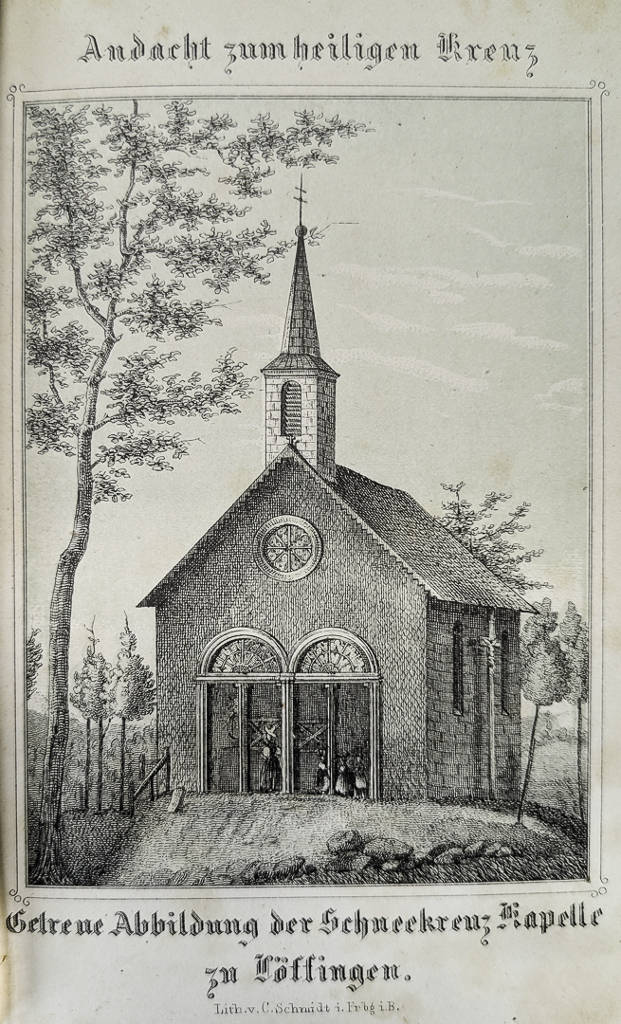Dieses Foto stellte dankenswerterweise Genoveva Kinast zur Verfügung.
In der NS-Zeit wurden die Prozessionen an Fronleichnam von den staatlichen Behörden behindert und eingeschränkt. In der Nachkriegszeit wird wieder an das religiöse Brauchtum angeknüpft. Nicht nur durch die Innenstadt führt die Prozession der katholischen Kirchengemeinde, sondern auch über den Alenberg.
Der gesamte Weg ist mit einem Blumenteppich versehen. Zweige mit jungem Grün sind links und rechts der Straße in das Pflaster gesteckt, um die Prozessionsstrecke einzurahmen. Zwischen dem Haus Gaede (Alenbergstr. 23) und dem Haus Zimmermann (Alenbergstr. 24) ist in diesem Jahr ein besonders aufwändig gestalteter Fronleichnamsschmuck installiert: Eine Art Ehrenpforte, von zwei Säulen getragen und von einem begrünten Bogen überspannt, der von einem kleinen Kreuz gekrönt wird.
Sie Säulen aus Gips sind vermutlich von der Gipser-Familie Adrion geschaffen worden, die gleich nebenan im Haus Alenbergstr. 21 wohnt.
Standort des Fotografen: 47.886412, 8.343143