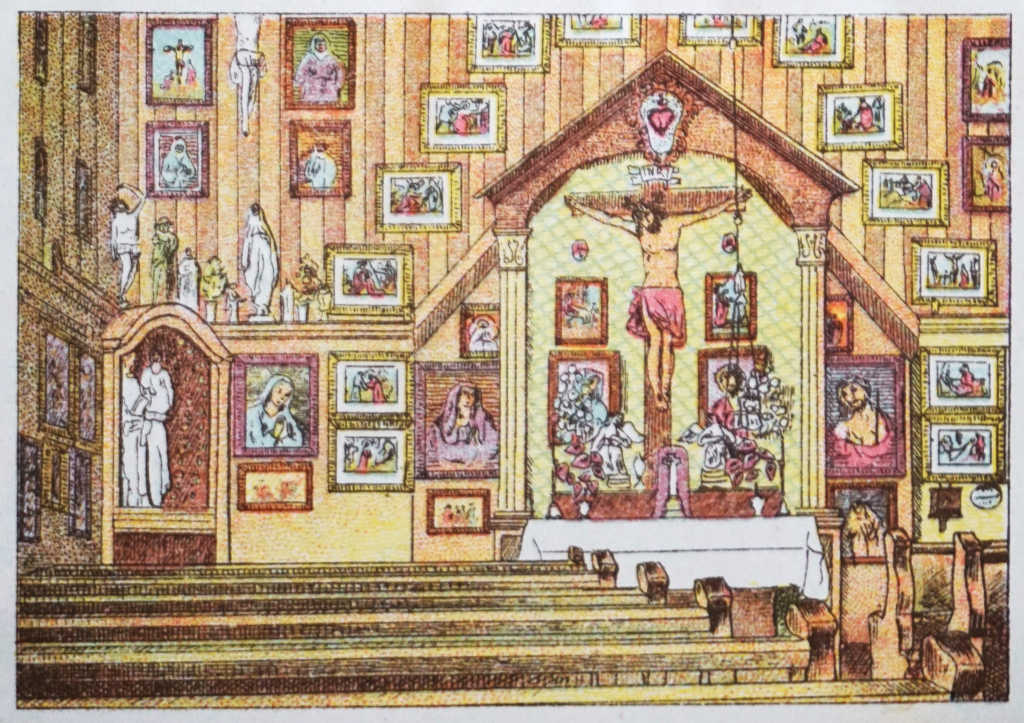Dieses Foto stellte dankenswerterweise Hilde Adrion zur Verfügung.
Feierlich zieht die Prozession die Seppenhofer Straße hinauf. Soeben ist der Festgottesdienst in der katholischen Pfarrkirche St. Michael zu Ende gegangen, nun begleiten Familien, Verwandte und Gemeindemitglieder die Erstkommunionkinder bis zur Kaplanei. Der Zug wird von der Stadtmusik angeführt, dahinter schreiten drei Ministranten mit Kreuz und Fahnen. In geordneten Reihen folgen die Mädchen in ihren weißen Kleidern und die Jungen im dunklen Anzug – festlich gekleidet, ernst und zugleich ein wenig stolz.
Am Straßenrand drängen sich die Angehörigen. Man winkt, ruft leise Namen, versucht einen Blick auf die Kommunionkinder zu erhaschen. Für viele ist es ein bewegender Moment – nicht nur ein kirchliches Fest, sondern ein sichtbarer Schritt ins Heranwachsen.
Im Hintergrund steht das 1949 erbaute Haus Gwinner (Seppenhofer Straße 2). Das Mauerwerk liegt noch unverputzt offen, doch hinter den Fenstern hängen bereits Gardinen: Das Haus ist bezogen, der Alltag hat Einzug gehalten. Rechts im Bild ist das frühere Pfarrhaus (Untere Hauptstr. 10) zu erkennen. Es wurde beim Bombenangriff am 22. Februar 1945 zerstört und steht seitdem leer.
Zu den Kommunionkindern zählt vermutlich Rita Hepting (verh. Zimmermann, geb. 1941).
Standort des Fotografen: 47.882098, 8.344373