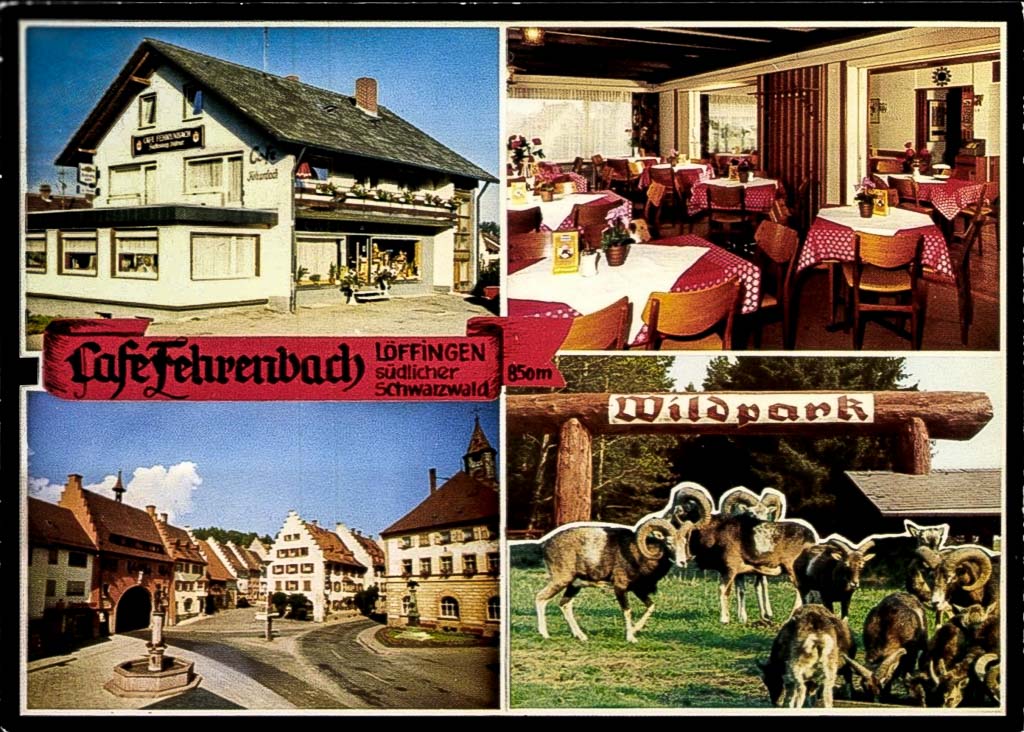F.F. Archiv, Donaueschingen
Vom 30. August bis zum 10. September 1894 findet bei Löffingen ein großes Manöver einer gemischten Kavalleriedivision statt. Daran teil nehmen vier badische Dragoner-Regimenter und zwei württembergische Ulanen-Regimenter. Am 30. August 1894 beginnt die Militärübung in Gegenwart des badischen Großherzogs Friedrich I. (1856-1907). Bevor er Löffingen am Abend verlässt, um nach Donaueschingen und von dort weiter nach Metz zu reisen, findet eine Parade im Gewann »Breiten« statt. In der Lokalzeitung heißt es, die Parade sei der »Glanzpunkt« des gesamten Manövers gewesen.
Das Foto ist eine von zwei Aufnahmen, die die Militärparade zeigt. Die Regimenter sind auf ihren Pferden zu sehen. Zeithistorisch besonders interessant ist der Hintergrund der beiden Fotos, ist doch das Städtchen in einer der ältesten Gesamtansichten zu sehen. Der Blick fällt von der »Breiten« in Richtung »Härte«, also in die heutige Seppenhofer Straße und den heutigen Pfarrweg. Die Bahnlinie existiert noch nicht, sie wird erst einige Jahre später gebaut. Daher ist das Gelände noch nicht zerschnitten und die Regimenter haben genügend Platz, um sich zu versammeln.
Die katholische Pfarrkirche St. Michael ist auf dem Foto deutlich zu sehen. Rechts daneben stehen das Haus von Briefträger Heinrich Fahrer (Seppenhofer Str. 1), die katholische Kaplanei und das Haus von Tapezierer Michael Baader (Seppenhofer Str. 5). Im heutigen Pfarrweg schließen sich die Anwesen von Schreiner Josef Victor Heiler (Pfarrweg 1) und von Waldhüter Anton Maier (Pfarrweg 2) an.
Standort des Fotografen: 47.881748, 8.341259