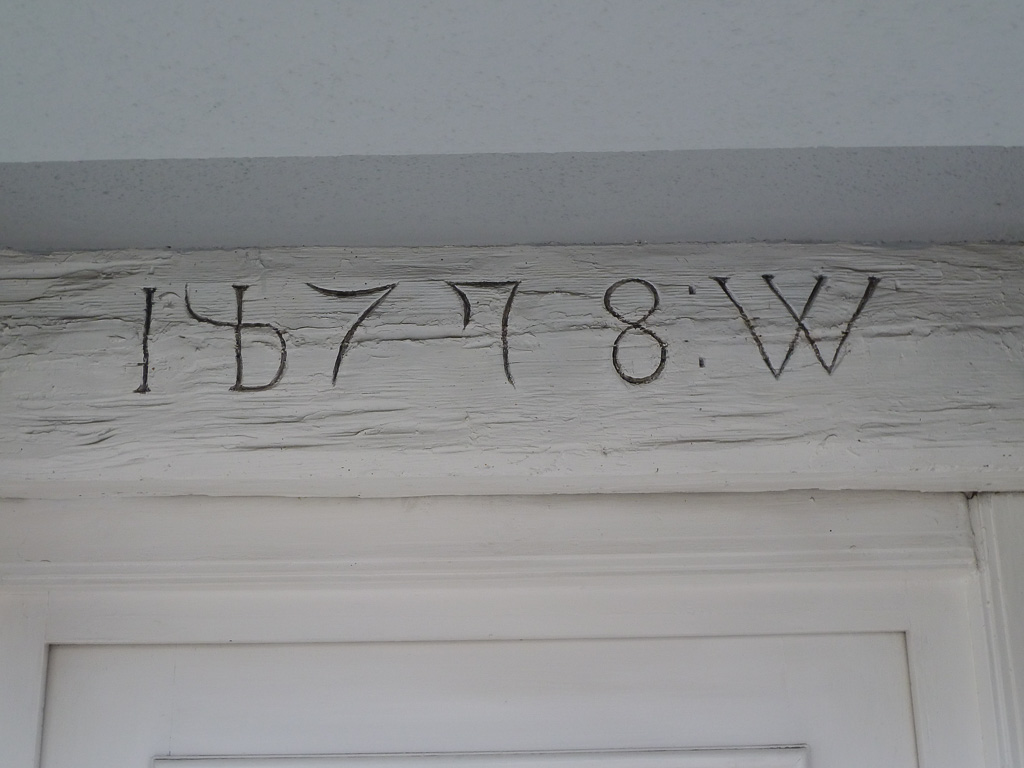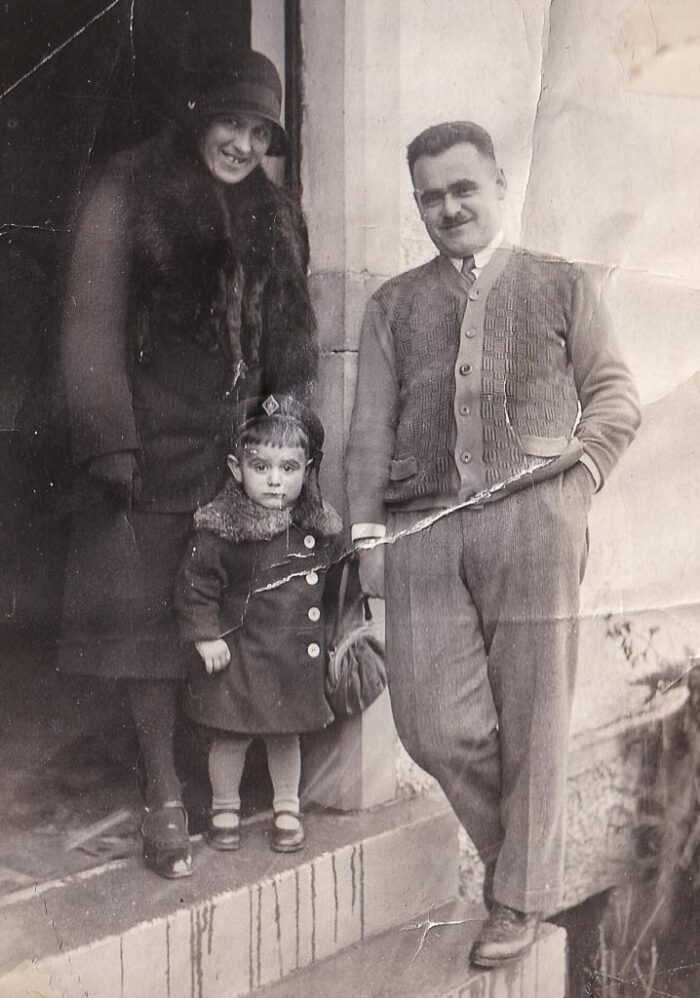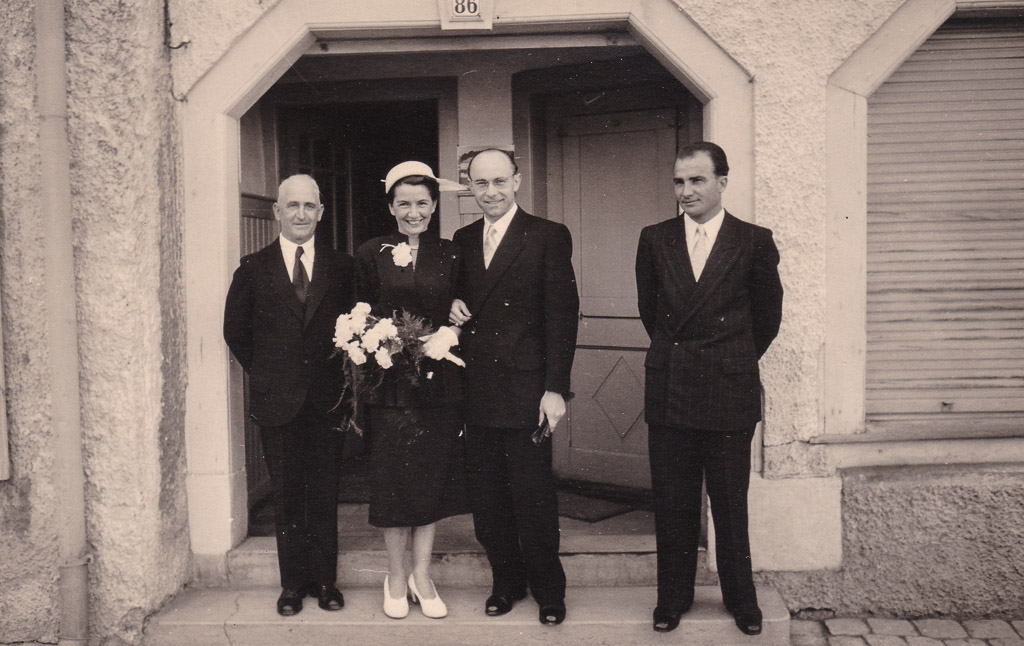Dieses Foto stellte dankenswerterweise Ursula Moch-Weiss zur Verfügung.
Drei Mädchen haben sich Hand in Hand vor dem Haus Krauß (Demetriusstr. 2) aufgestellt. Es ist Fasnacht und der Ernst in ihren Gesichtern steht in einem reizvollen Kontrast zu ihren Kostümen.
Links trägt das älteste der drei Mädchen ein fröhlich gemustertes Kleid mit großen Punkten, darüber eine dunkle Weste mit Zierborten und ein Stirnband im Haar. Der Rock fällt weit, darunter weiße Strümpfe und geschnürte Halbschuhe. In der Mitte steht ein jüngeres Mädchen, die Kleinste der Gruppe. Sie trägt ein Kleid mit geschnürtem Mieder, darüber eine helle Schürze mit Spitzenbesatz. Ganz rechts schließlich steht ein Mädchen in Löffinger Tracht mit der charakteristischer Haube. In der Hand hält sie ein kleines Körbchen – ein liebevolles Detail, das die Tracht vervollständigt.
V.l.n.r.: 1 ???, 2 ???, 3 ???
Standort des Fotografen: 47.884294, 8.344938