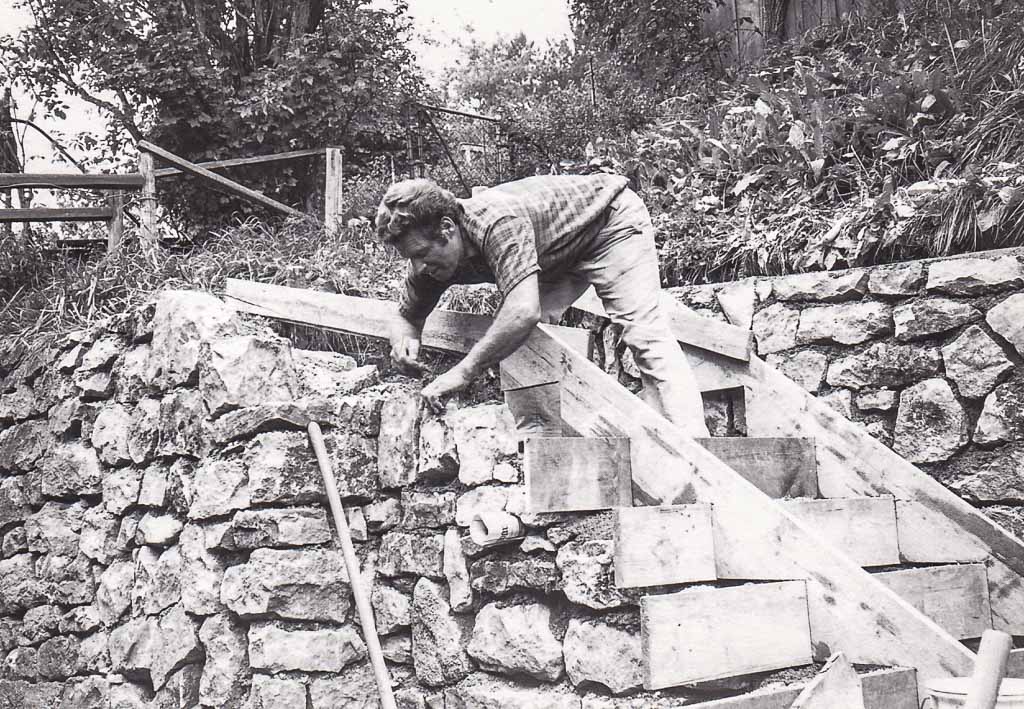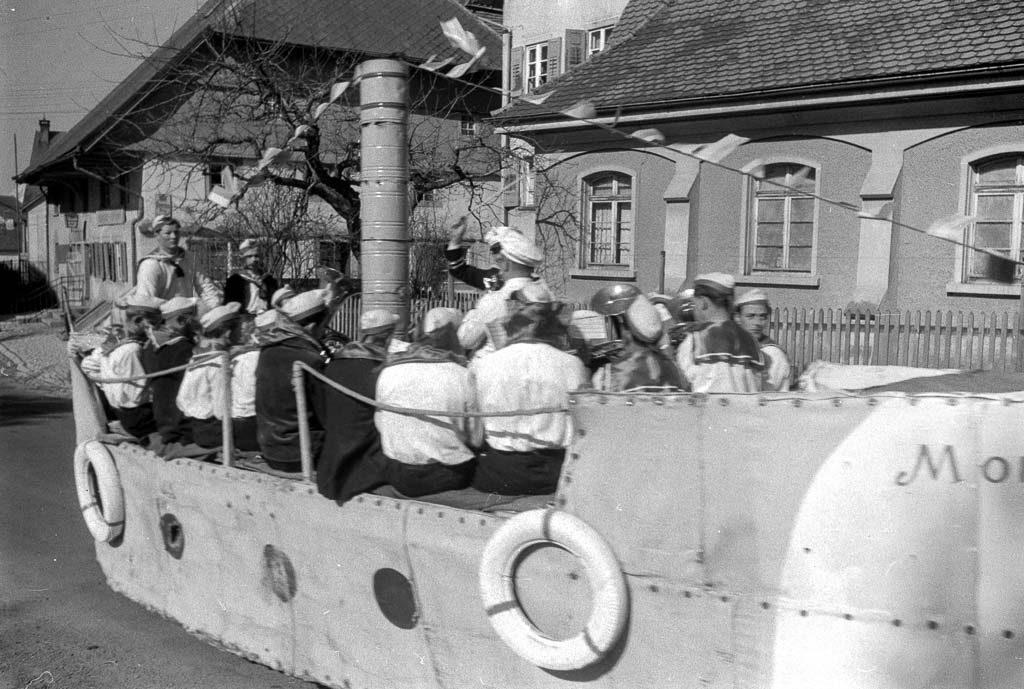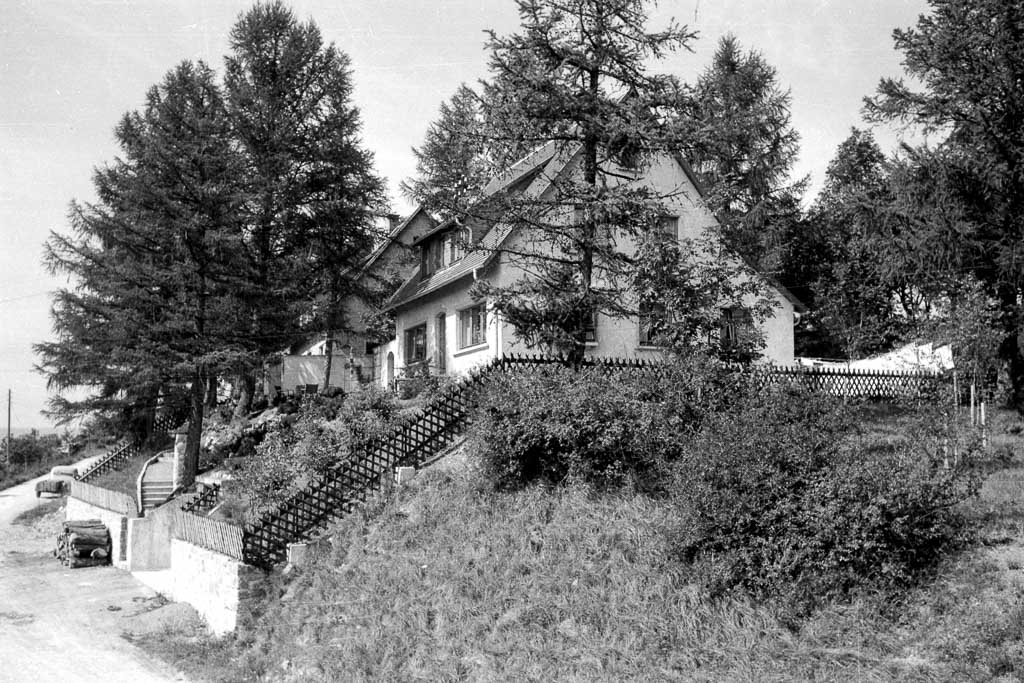Dieses Foto stellte dankenswerterweise Inge Mayer zur Verfügung.
Der jüngste Spross der Familie Jonner ist soeben in der katholischen Pfarrkirche St. Michael getauft worden. Nun macht sich die kleine Taufgesellschaft auf den Heimweg durch die Alenbergstraße. Der Säugling wird – wie üblich – nicht von der Mutter getragen, die nach der Geburt noch im Wochenbett liegt, sondern von der Patentante. Behutsam hält sie das Neugeborene im weißen Taufkleid im Arm.
Neben ihr schreitet ein festlich gekleideter Mann, im dunklen Anzug und mit Zylinder – der Patenonkel des Kindes. Rechts von ihnen geht die Hebamme Veronika Geisinger (geb. Mauthe, 1878-1958), die nicht nur die Geburt begleitet hat, sondern traditionell auch bei der Taufe anwesend ist. In Zeiten, in denen fast ausschließlich zuhause entbunden wird, spielt die Hebamme eine herausragende Rolle: Sie sorgt für Mutter und Kind, kümmert sich in den ersten Lebenstagen – und begleitet die Familie bis zur kirchlichen Aufnahme des Neugeborenen. Die Taufe erfolgt meist sehr zeitnah nach der Geburt, auch aus Sorge, das Kind könne versterben, bevor es getauft ist.
Die Taufgesellschaft und Hebamme Geisinger teilen denselben Heimweg, denn auch sie wohnt auf dem Alenberg. Vermutlich handelt es sich bei dem Täufling um Bernhard Jonner, geboren am 16. Januar 1936 als Sohn von Wilhelm Jonner (1902-?) und Josefine Jonner (geb. Guth, 1905-?).
V.l.n.r.: 1 Patenonkel Oskar Guth, 2 Patentante Sofie Hepting (geb. Jonner, 1909-1995), 3 Hebamme Veronika Geisinger (geb. Mauthe, 1878-1958)
Standort des Fotografen: 47.884813, 8.344858