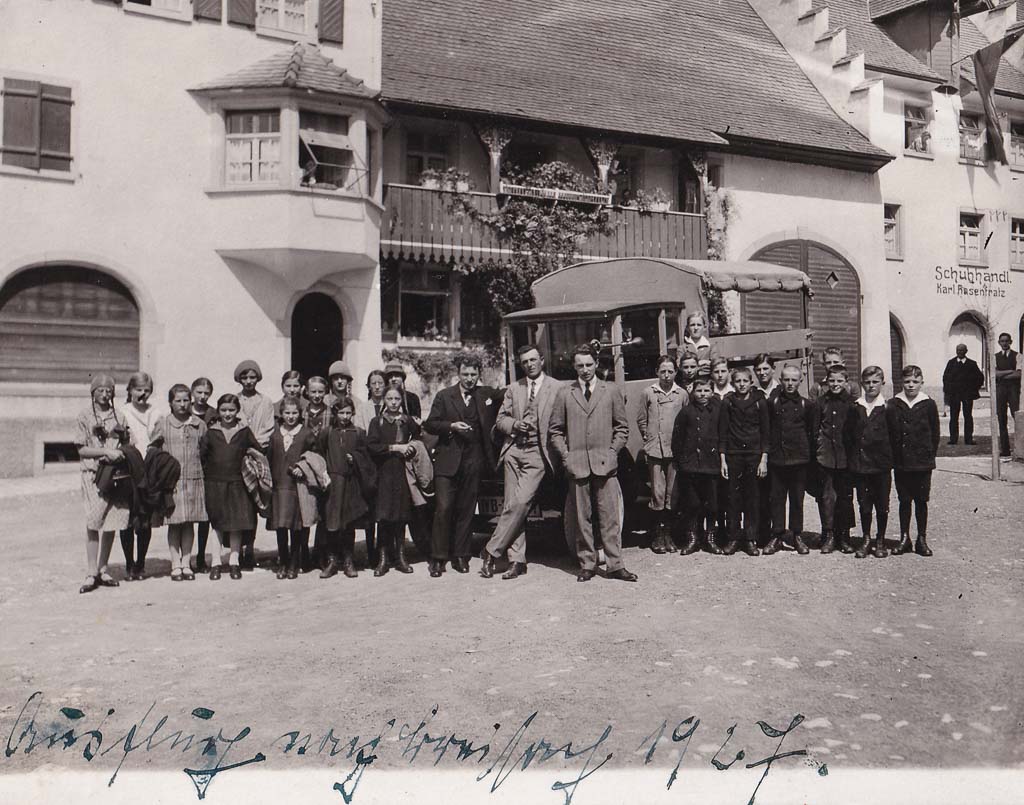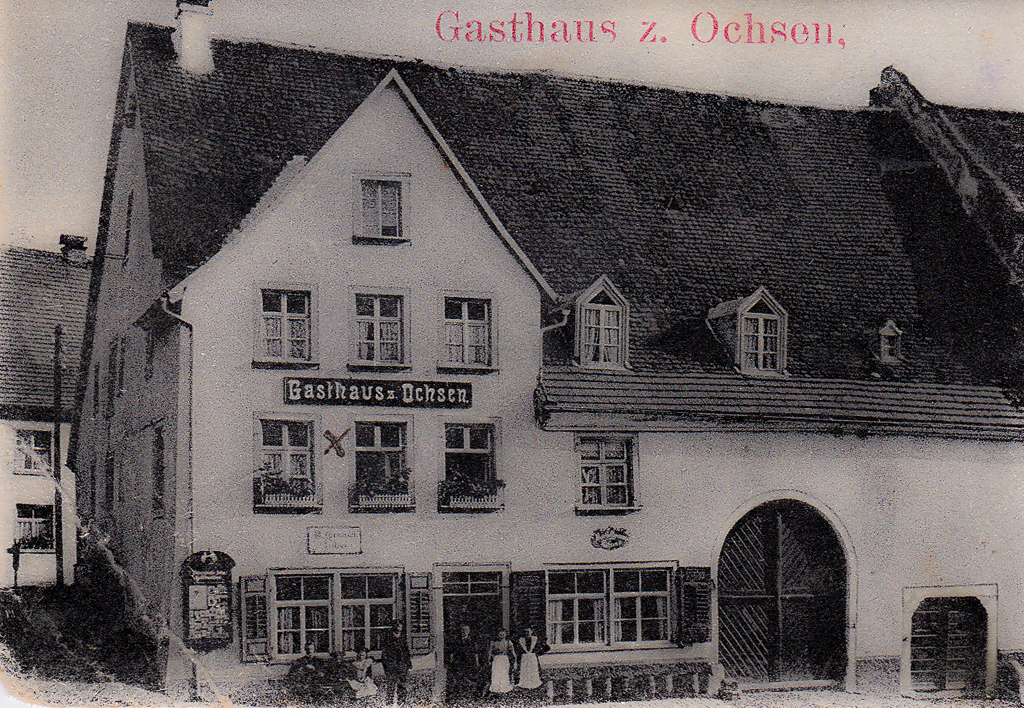Dieses Foto stellten uns dankenswerterweise Beate und Franz Hofmeier zur Verfügung.
Da haben die Narren aber noch ordentlich was zu tun, wenn sie den Winter austreiben wollen! Im Maienland türmt sich die weiße Pracht rechts und links der Straße. Das Haus von Schneidermeister Hermann Ganter (1895-1957) ist eingeschneit. Die Narren rollen mit schwerem Gerät an. Sind es Römer? Sind es Germanen? Ist es vielleicht die »Hermannschlacht« im Teutoburger Wald, die sich gleich im Maienland ereignen wird? Immerhin lautet das Motto der diesjährigen Fasnacht: »Als die Römer frech geworden«.
Die Narrengruppe besteht aus Mitgliedern vom Männergesangverein »Eintracht«. Zu sehen sind u.a. Otto Schmitt, Willy Siefert, Fritz Strobel (1906-1997) und Albert Benitz (1905-1996).
Standort des Fotografen: 47.885250, 8.342521