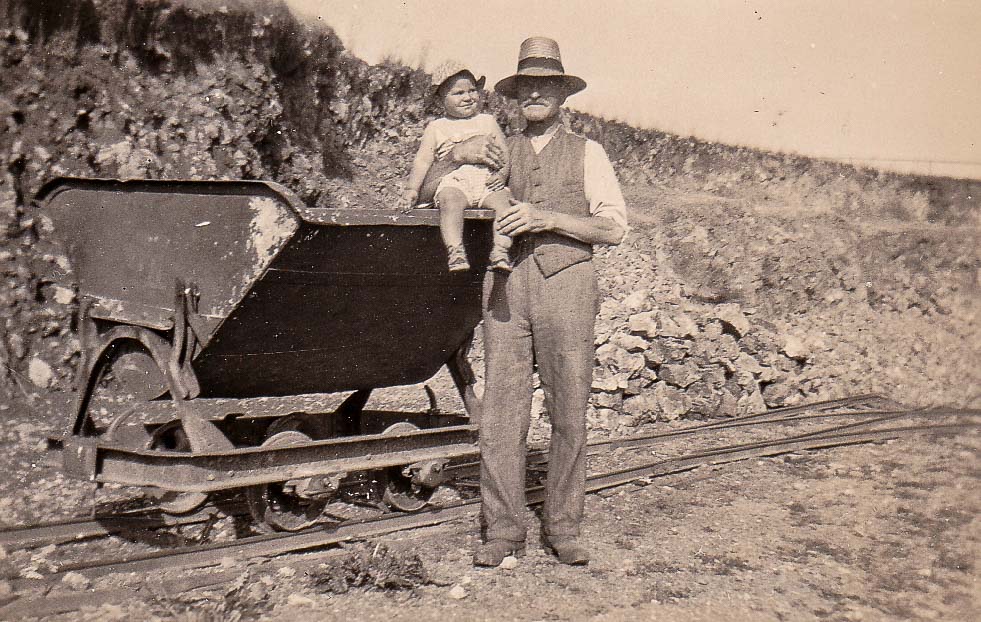Verlag A. Rebholz
Dieses Foto stellte uns dankenswerterweise Jutta Knöpfle zur Verfügung.
Im Dezember 1935 eröffnete im Mittelbau, der die Turn- und Festhalle mit der Volksschule verbindet, das Heimatmuseum. Auf Anregung des nationalsozialistischen Bürgermeisters Heinrich Andris schuf Gewerbelehrer Karl Ehret, der seit 1919 an der Schule in Löffingen wirkte, das Museum. Mit großem Engagement sammelte er Objekte, die die lokale Geschichte Löffingens, aber auch die regionale Geschichte der Baar und des Schwarzwaldes repräsentieren. »Museum« ist freilich ein großes Wort, da die Exponate unwissenschaftlich präsentiert und ihre konkreten Objektgeschichten nicht erzählt wurden. Auch ihre Provenienz (Herkunft) und ihr Zusammenhang zur lokalen Geschichte blieben meist unklar. Angesichts dessen wäre »Heimatstube« wohl ein passenderer Begriff.
Das Foto zeigt den Ausstellungsbereich »Heimat und Frieden«. In der Raumecke ist eine Bauernstube mit originalem Mobiliar zu sehen, ein Holztisch, ein Stuhl und ein Kachelofen mit Ofenbank. Über dem Tisch hängt im »Herrgottswinkel« ein Kruzifix. Für das Foto wurde eine Hansele-Figur mit bemaltem Leinengewand, Geschellriemen und geschnitzter Holzmaske aufgestellt. Eigentlich hatte der Weißnarr sonst an anderer Stelle in der Ausstellung seinen festen Platz. An der Wand hängen allerlei Bilder, Hinterglasmalereien, eine Schwarzwalduhr und verschiedene gerahmte Urkunden, die Karl Ehret mühsam zusammentrug.
Standort des Fotografen: 47.882678, 8.347749