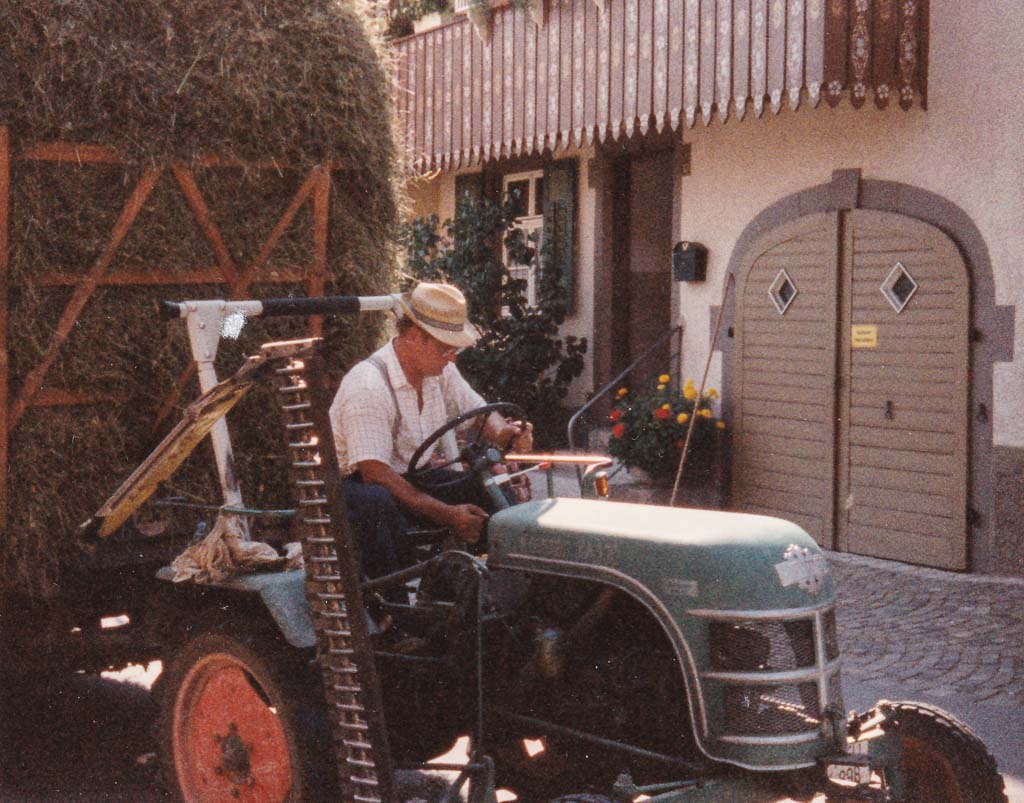Diese Fotos stellten dankenswerterweise Dorothea und Michael Kasprowicz zur Verfügung.
Der obere Rathausplatz ist voller Menschen. Fast scheint es, dass alle Einwohner*innen des Städtchens auf den Beinen sind. Es ist der 2. März 1930, wie auf den Fotos notiert ist, ein Sonntag – und in Löffingen wird Fasnacht gefeiert. Das Motto lautet: »Generalmusterung und Besuch Seiner Majestät des Kaisers«. Der musste zwar im November 1918 abdanken und verschwand ins niederländische Exil, aber anlässlich der närrischen Tage kehrt er nach Löffingen zurück.
Auf den Fotos sind freilich keine einzelnen Narrengruppen oder Details wie Kostüme zu erkennen. Zu sehen ist vor allem die dichte Menschenmenge, die die Umzugstrecke einrahmt und sich rund um den Rathausbrunnen drängt. Männer, Frauen und Kinder stehen Schulter an Schulter, viele mit Hüten und Mänteln, einige auf Fensterbänken oder erhöhten Standpunkten, um besser sehen zu können. Stimmengewirr, Gelächter und Musik liegen in der Luft. Pferde, die vor einen Holzkarren gespannt sind, warten geduldig am Rand des Menschenauflaufs, während sich der Platz immer mehr füllt und das närrische Treiben seinen Lauf nimmt.
Der Rathausplatz wird eingerahmt vom 1909 erbauten »Stadtbau« (Demetriusstr. 1), in dem sich die Gewerbliche Fortbildungsschule befindet, und vom Haus Nägele (Rathausplatz 2), das der Kaufmannswitwe Lina Nägele (geb. Ott) gehört, sowie vom Postamt (Rathausplatz 3). Die beiden letzteren Häuser waren ursprünglich ein Gebäude, wie noch an der durchgehenden Dacheindeckung zu erkennen ist. Nur die Fassadengestaltung unterscheidet sich stark. Einst war es das Fürstenbergische Amtshaus und wurde von den Einwohner*innen respektvoll »Schloss« genannt. Nach der Auflösung des Fürstentums Fürstenberg kam Löffingen zum neu gegründeten Großherzogtum Baden und das Haus diente zunächst weiterhin als Dienstgebäude. Majestäten haben hier zwar nie verkehrt, aber als herrschaftliches Gebäude ist es die perfekte Kulisse für das närrische Treiben und den fiktiven »Besuch Seiner Majestät des Kaisers«.
Standort des Fotografen: 47.883861, 8.344760