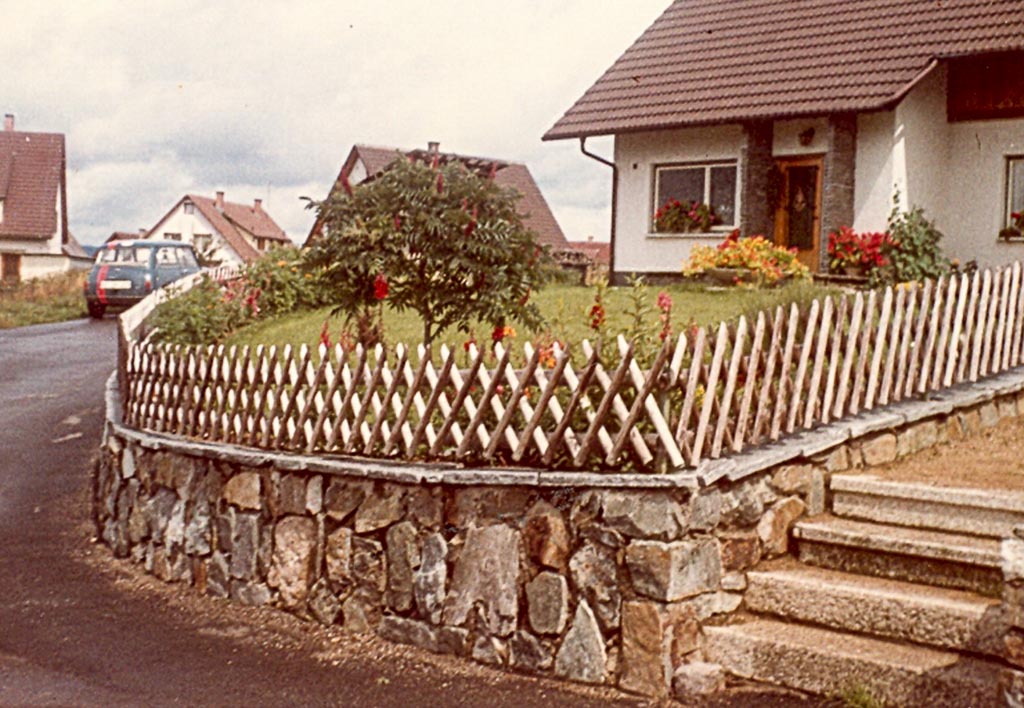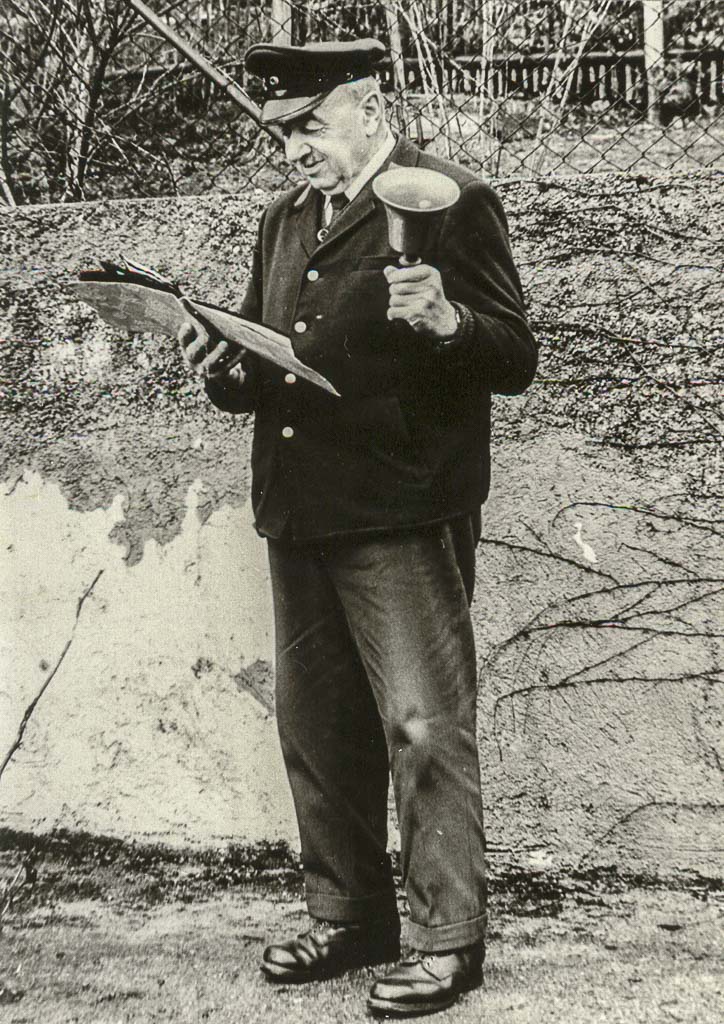Diese Fotos stellte uns dankenswerterweise Willi Pütz zur Verfügung.
Das Gasthaus »Löwe« (Rathausplatz 11) wurde 1715 erbaut, nachdem das Vorgängergebäude »durch einen Blitzschlag verloren gegangen«, also abgebrannt war. Doch die Anfänge des Gasthauses reichen sehr viel weiter zurück, denn bereits 1653 befand sich hier ein Gasthaus »Löwe«. Damaliger »Lewenwirt« war Jakob Hug.
Seitdem sind mehr als 300 Jahre vergangen. Die heutigen Wirtsleute sind Walter Zepf (1924-2009) und Elisabeth Zepf geb. Jordan (1930-2009), »Löwen Lisbeth« genannt. Sie steht vor der Eingangstür und unterhält sich mit zwei Männern. Über ihnen sind die teilweise weit geöffneten Fenster zu sehen, eingerahmt durch hölzerne Fensterläden und mit Blumen geschmückt.
Dank der Nahaufnahme lassen sich mehrere Details erkennen, die auf anderen Fotos leicht übersehen werden. Oben links sind Fähnchen von verschiedenen Ländern zu sehen, denn der »Löwe« gibt sich weltoffen und international. Tatsächlich spricht die Wirtin Elisabeth Zepf fließend französisch. In der Mitte der Fassade ist ein Schild mit dem offiziellen Namen das Gasthauses angebracht: »Goldener Löwe Post«. Daneben wird geworben, dass das Gasthaus über »Fremdenzimmer, Saal, Garage« verfüge und »Rothaus- u. Rogg-Biere« ausschenke. Auf einem weiteren Schild ist zu lesen, dass es »Zentralheizung, fliessendes Warm- u. Kaltwasser« gebe.
Links und rechts vom Eingang sind weitere Werbeschilder angebracht, u.a. ein Emaille-Schild des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC). Ein Aufsteller wirbt für »Langnese Eiskrem«, wobei das – erst seit 1965 verwendete – Firmenlogo einen Hinweis gibt, wann das Foto aufgenommen wird. Der perfekte Ort, um das Eis zu schlecken, befindet sich gleich nebenan, in dem kleinen, von einem Mäuerchen eingefassten Vorgärtchen, in dem zwei Kastanienbäumen Schatten spenden.
Standort des Fotografen: 47.883917, 8.344919