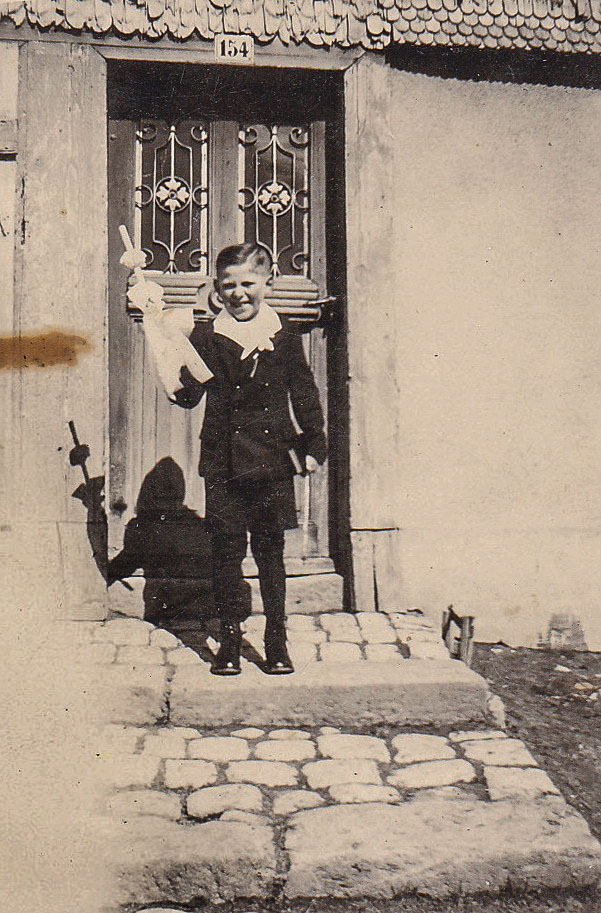Dieses Foto stellte uns dankenswerterweise Brigitte Mayer zur Verfügung.
1989 feiern die »Laternenbrüder« ihr 100. Gründungsjubiläum. Für ein Gruppenfoto versammeln sie sich wenige Monate zuvor am Hexenbrunnen in der Kirchstraße. Sie tragen ihren blauen Kittel zur schwarzen Hose, ihren schwarzen Rundhut – und führen natürlich eine Laterne mit sich. Hinter ihnen ist das Haus Kuster (Kirchstr. 14) zu sehen.
V.l.n.r. Josef Lentz, Conrad Bader, Johann Fritsche, Narrenvater Josef (Jupp) Hoitz, Franz Scholz, Hermann Zahn, Manfred Mayer
Die Gruppe ist unvollständig, es fehlen: Dieter Butsch, Georg Mayer, Franz Riede und Konrad Schwörer.
Im Hintergrund links sind Diethelm Fuß und Martin Lauble zu sehen.
Standort des Fotografen: 47.882969, 8.344210