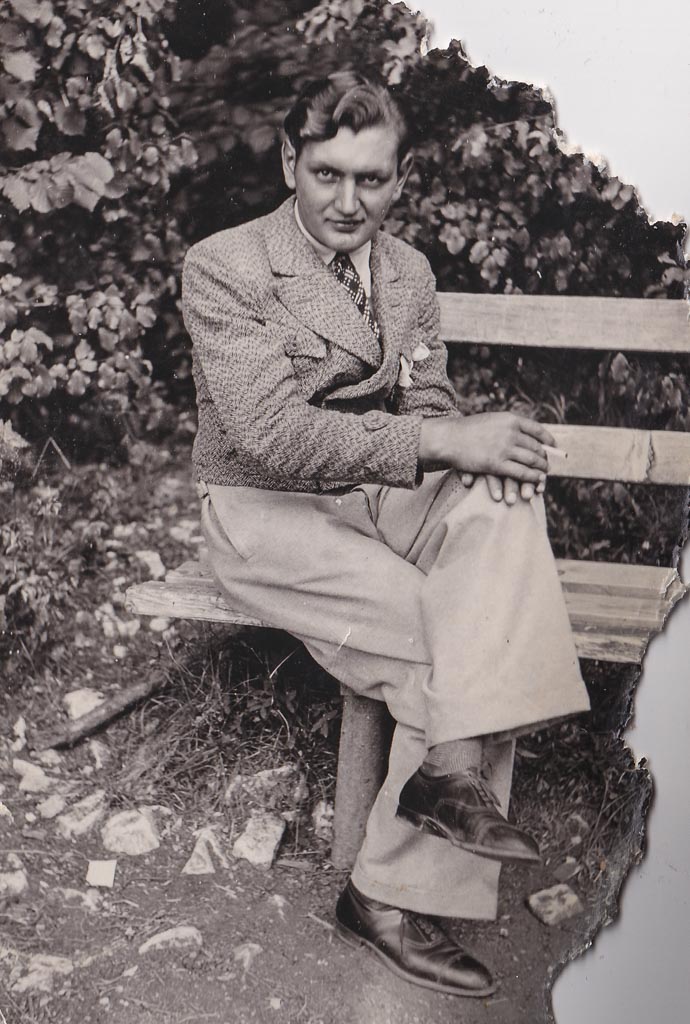Dieses Foto stellte dankenswerterweise Hilde Adrion zur Verfügung.
Vier junge Musiker stehen geschniegelt in dunklen Uniformröcken mit doppelter Knopfreihe, breiten Gürteln und auffälligen, glänzenden Helmen. In ihren Händen halten sie Blasinstrumente, wie Trompete und Horn. Unten auf dem Foto steht in schwungvoller Handschrift: »Frohnleichnahm 1935« – mit gleich zwei überflüssigen »h«. Das menschliche Gedächtnis – und manchmal auch die Rechtschreibung – irrt eben gelegentlich.
Die vier Musiker gehören der Stadtmusik an, die bis 1920 bei der Feuerwehr eingegliedert ist. Die alten Uniformen werden weiter genutzt, deswegen auch die Feuerwehrhelme. Fronleichnam ist ein Hochfest mit feierlicher Prozession, bei der Musik nicht fehlen darf.
Die Szene wirkt wie ein spontaner Schnappschuss am Rande der Feierlichkeiten. Die jungen Männer schauen nicht alle selbstbewusst in die Kamera: Einer blickt abgelenkt zur Seite, ein anderer blickt lächelnd gen Himmel. Gerade diese leichte Unbeholfenheit verleiht dem Bild seinen Charme. Es zeigt nicht nur vier Musiker in einem festlichen Moment, aber mit ganz und gar menschlicher Ausprägung.
V.l.n.r.: 1 ???, 2 ???, 3 ???, 4 ???
Standort des Fotografen: ???